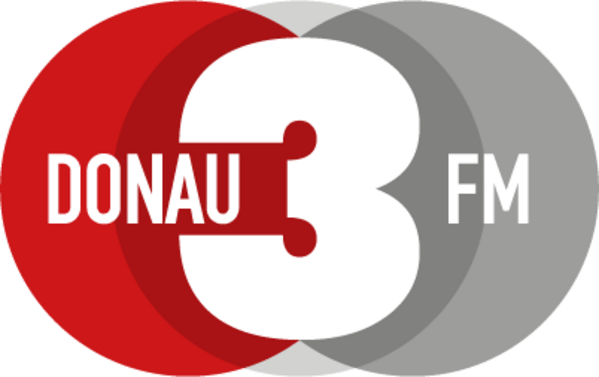Als der Onkel stirbt, ist für die Verwandten klar: Die betagte Tante kann nicht mehr allein im großen Haus leben. Die sieht das allerdings anders. Sie will nicht ins Seniorenstift. Und fremde Leute im Haus sieht sie auch nicht gern. Die früher anderen zugewandte Frau ist misstrauisch geworden. Wochenweise umsorgen nun die weit entfernt wohnenden Nichten die alte Dame. Vorerst. Doch lange kann das so nicht weitergehen. Die Sorge um die hilfsbedürftige Tante bereitet einer Karlsruherin schlaflose Nächte.
Ähnliche Probleme haben auch andere Angehörige. Was tun, wenn Mutter, Vater oder andere Verwandte den Alltag allein nicht mehr bewältigen können, aber in den eigenen vier Wänden bleiben wollen? Diese Frage dürften sich in den nächsten Jahren immer mehr Menschen stellen.
Weder Heim noch fremde Hilfe? Viele Ältere stehen vor einem Dilemma
Nach Berechnungen des Statistischen Bundesamtes könnte die Zahl Pflegebedürftiger allein durch die zunehmende Alterung von bundesweit nun 5 Millionen bis zum Jahr 2055 auf rund 6,8 Millionen steigen – ein Plus von 37 Prozent im Vergleich zum Jahr 2021. In Baden-Württemberg könnte die Zahl bis dahin auf 815 000 und damit verhältnismäßig noch stärker wachsen (plus 51 Prozent). Für 2035 geht die Berechnung hier von 634 000 Pflegebedürftigen aus. Grund ist die Generation der «Babyboomer», die jetzt in Rente geht.
Und die wollen vor allem eins: Auch im hohen Alter nicht ins Heim. 80 bis 90 Prozent wollen zu Hause alt werden, schätzt der Landesseniorenrat Baden-Württemberg. Dieser Wunsch hat Priorität, ergab eine Studie des Deutschen Instituts für angewandte Pflegeforschung in Köln.
Um Eltern, Tanten oder Onkel kümmern
Für Angehörige kann das herausfordernd sein. Nicht alle können oder wollen sich um Eltern, Tanten oder Onkel kümmern. Und manche Ältere haben niemanden. Außer vielleicht der Polizei, die – wie in Karlsruhe – öfter mal die ein oder andere orientierungslose Seniorin in die Wohnung zurückbringt. Ambulante Pflegedienste können helfen. Doch die pflegerische Versorgung ist nach Angaben des Bundesverbandes privater Anbieter sozialer Dienste schon jetzt vielerorts nicht mehr gesichert.
Nach einer Pflegestudie des Sozialverbandes VdK werden in Baden-Württemberg über 80 Prozent von derzeit rund 550 000 Pflegebedürftigen zu Hause versorgt – vor allem vom Partner, den Töchtern oder Söhnen. Für sie sind neben dem Medizinischen Dienst der Krankenversicherung, der die Pflegebedürftigkeit feststellt, Pflegestützpunkte bei den Landkreisen oft erste Ansprechpartner. Ob Betreuungs- und Pflegedienste, Tages- und Nachtpflege, Senioren-WGs oder finanzielle Unterstützung wie die Hilfe zur Pflege – welche Hilfen es gibt, wissen die wenigsten. Aus Sicht des VdK wäre deshalb mehr Beratung nötig.
«Gänzlich unversorgt sollte keiner in Deutschland bleiben müssen», sagt der Kölner Pflegeprofessor Michael Isfort. Verwandte sind dabei nicht in der Pflicht: «Niemand wird gezwungen, die Pflege für einen Dritten zu übernehmen», betont eine Sprecherin des Landratsamtes Karlsruhe. Die Entscheidung sollte immer freiwillig getroffen werden. Und: «Wenn die Belastung zu groß wird oder die Pflege nicht mehr geleistet werden kann, ist es ratsam, rechtzeitig Unterstützung in Anspruch zu nehmen.»
Andererseits muss sich auch niemand helfen lassen. Im Zuge der verfassungsrechtlich geschützten individuellen Freiheit kann jeder selbst entscheiden, ob er Hilfe in Anspruch nimmt, betont ein Sprecher des Stuttgarter Sozialministeriums. Es sei denn, es besteht die Gefahr erheblicher Selbst- oder Fremdgefährdung. Auf der Grundlage könnte mit Genehmigung des Betreuungsgerichts etwa ein schwer Demenzkranker gegen seinen Willen im Pflegeheim untergebracht werden. Nach Angaben des baden-württembergischen Justizministeriums waren im vergangenen Jahr 5260 Verfahren anhängig zu freiheitsentziehenden Unterbringungen von Menschen, die unter rechtlicher Betreuung stehen.
Selbstbestimmung schließt Extremfälle ein
Selbstbestimmung schließt Extremfälle ein: «Jeder hat auch das Recht, zu verwahrlosen», sagt Eckart Hammer, der Vorsitzende des Landesseniorenrats. Für Angehörige sei das schwer auszuhalten. Sie müssten aber lernen, sich abzugrenzen und zu schützen. Das sei ähnlich schwer wie für Familien von Alkoholkranken. Notfalls gelte aber: «Lasst den Menschen abstürzen», sagt der frühere Professur für Soziale Gerontologie an der Evangelischen Hochschule in Ludwigsburg.
Tanja Fröhlich, Sozialpädagogin und Leiterin des Pflegestützpunktes Baden-Baden, hat häufiger weinende Angehörige vor sich, die nicht mehr weiter wissen. «Wir versuchen dann, den Druck herauszunehmen und bieten an, mit dem Vater oder der Mutter zu sprechen.» Doch selbst wenn das Zuhause zur Messie-Wohnung geworden ist, ist das Sache des Bewohners. Auch Fröhlich sagt: «Letztlich hat jeder das Recht auf Verwahrlosung.»
Dass jemand jede Hilfe verweigert, ist nach Beobachtung des Landratsamtes Karlsruhe sehr selten. Seniorenverbandschef Hammer geht aber davon aus, dass sich problematische Fälle angesichts von mehr Älteren häufen werden. Er rät, sich rechtzeitig Gedanken darüber zu machen, wie man im Alter leben will. «Die meisten schieben das zu lange weit von sich.»
Ambulantes Netzwerk der Altenhilfe ausbauen
Wer zu Hause alt werden will, sollte zumindest sein Heim rechtzeitig altersgerecht ausstatten und gute Nachbarschaften pflegen. Eine Demenzdiagnose bedeutet nach Sozialpädagogin Fröhlich auch für Alleinstehende nicht gleich den Umzug ins Heim. Davor gebe es viele Schritte – von stunden- und tageweisen Hilfen über Betreuungsdienste bis hin zu Herdabschaltungen und gebrachtem Essen. «Nur, weil jemand an Demenz oder an einer Depression erkrankt ist, kann man ihn nicht einfach wegsperren. Das muss man aushalten können.»
Bevor die «Babyboomer» in Rente gehen, muss aus Sicht der Vize-Vorständin der Badischen Diakonie, Manuela Striebel-Lugauer, das ambulante Netzwerk der Altenhilfe dringend ausgebaut werden. «Man will Menschen so weit wie möglich auch im Alter eigenbestimmt lassen. Die Grenzen zu finden – das ist die Kunst.» Angesichts von zu wenig Pflegepersonal schon heute und absehbar mehr Pflegebedürftigen könnten aus Sicht der Diakonie-Altersexpertin neue Strukturen und verstärkte Hilfe von Angehörigen nötig werden. «Es muss ein gesellschaftliches Umdenken geben, sonst werden wir die Versorgung Pflegebedürftiger nicht sicherstellen können.»
(Susanne Kupke, dpa)